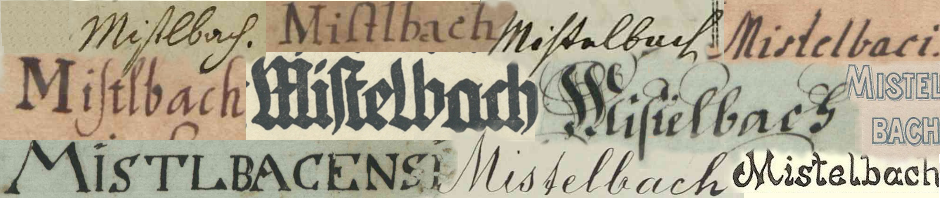Stadtrat Franz Lang

* 24.2.1892, Mistelbach
† 29.11.1965, Mistelbach
Franz Lang wurde 1892 als Sohn des Gärtners der hiesigen Landessiechenanstalt Alois Lang und dessen Gattin Katharina, geb. Deisch, in Mistelbach geboren.1 Sein Vater, der aus Prag zuzog und bald nach der Eröffnung des Siechenhauses hierher kam, schuf auch die Pläne für die in den 1890ern durch den „Verschönerungsverein 1885“ angelegten Parkanlagen (Stadtpark bzw. Liechtensteinanlage (Kirchenberg).2 Zusammen mit seinen Eltern und zwei älteren Brüdern wuchs Lang in einer Dienstwohnung in der Landessiechenanstalt, die sich einst auf dem Areal des heutigen Pflege- und Betreuungszentrums Mistelbach (Franziskusheim) befand, auf. Nach der Pflichtschulbildung an der Mistelbacher Volks- und Bürgerschule ergriff er wie sein Vater den Beruf des Gärtners und folgte diesem, wohl noch vor dem Ersten Weltkrieg, auch als Gärtner der Landessiechenanstalt nach.3
In den vom k. u. k. Kriegsministerium herausgegebenen Verlustlisten findet sich im März 1918 ein in Mistelbach geborener Franz Lang angeführt, allerdings unter Angabe des Geburtsjahrgangs 1891.4 Da im Jahr 1891 in Mistelbach jedoch keine Person dieses Namens geboren wurde, dürfte es sich hierbei wohl um einen Fehler handeln und es erscheint als sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei tatsächlich um den 1892 geborenen Franz Lang handelt, der Gegenstand dieses Beitrags ist. Demzufolge dürfte Franz Lang bei der 4. Kompanie des Infanterieregiments Nr. 84 gedient haben und Anfang 1918 nahe der russischen Stadt Nowosil in Kriegsgefangenschaft geraten sein. Die Meldung seiner Gefangennahme dürfte allerdings erst mit Verspätung eingetroffen bzw. veröffentlicht worden sein, denn zum Zeitpunkt der Bekanntmachung, Ende März 1918, war der mit Russland geschlossene Friedensvertrag bereits seit einigen Wochen in Kraft. Seine Kriegsteilnahme ist auch durch die im April 1940 erfolgte Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer belegt, mittels der die „Helden“ aus dem Ersten Weltkrieg geehrt und deren Mut und Opferbereitschaft als Vorbild für die aktuelle Kriegergeneration angepriesen wurde.5
Nach seiner Heimkehr kehrte Lang wieder an seinen Posten bei der Mistelbacher Landessiechenanstalt zurück und schloss am 20. Juli 1922 den Bund der Ehe mit Hermine Simperler und dieser Verbindung entstammten ein Sohn (Franz, *1922) und eine Tochter (Emma, *1924).6 Auch mit seiner neugegründeten Familie wohnte er zunächst in einer Dienstwohnung in der Landessiechenanstalt und im Juli 1939 erwarb er schließlich das unweit seines Dienstorts gelegene Haus Liechtensteinstraße Nr. 42 (Ecke Südtirolerplatz/Liechtensteinstraße)(Ecke Südtirolerplatz/Liechtensteinstraße)(Ecke Südtirolerplatz/Liechtensteinstraße) in der ehemaligen Flüchtlingssiedlung.7
1921 trat Lang dem 1864 gegründeten Männergesangsverein Mistelbach bei und führte diesen ab 1923 als Obmann zu neuer Blüte.8 Im Jahre 1934 kam es zu einer Fusion dieses Vereins mit dem zeitgleich bestehenden Musik- und Gesangsverein und Lang wurde zum Obmann der neuen Vereinigung gewählt, ein Amt, das er bis zur endgültigen Einstellung der Vereinstätigkeit im Frühjahr 1945 innehatte.9 Lang war weiters bei der „Mistelbacher Urania“, einer Volksbildungseinrichtung (Vorläufer der Volkshochschulen) engagiert10 und insbesondere auch im „Verschönerungsverein 1885“ aktiv und ab Anfang der 1930er Jahre auch dessen Obmann.11 In letzterer Funktion war er stets bemüht das Stadt- und Straßenbild seiner Heimatstadt ansehnlicher zu gestalten und die Aufstellung der 1945 abgebrochenen Statue des griechischen Gottes Hermes vor der damaligen gewerblichen Fortbildungsschule (heute: Polytechnische Schule) war seinem rastlosen Wirken geschuldet. Bei der Aufstellung dieser Hermes-Statue galt es Widerstände zu überwinden, denn einige Gemeindevertreter nahmen Anstoß an der Nacktheit des Dargestellten. Nach einiger Verzögerung und zähem Ringen wurde die Statue schließlich mit einem die Scham bedeckenden Bruchband aufgestellt. Bei diesem Kompromiss handelte es sich in den Augen von Lang um einen Kunstfrevel, dem er nur zähneknirschend zustimmte. Gemeinsam mit Fritz Bollhammer war Lang übrigens auch Autor der 1934 vom Verschönerungsverein herausgegebenen Werbebroschüre „Die Stadt Mistelbach an der Ostbahn, im Viertel unter dem Manhartsberg (Nordöstliches Weinland)“, die den ersten Versuch darstellte Mistelbach auch touristisch zu positionieren. Darüber hinaus war Lang (mindestens) zwischen 1929 und 1933 als gewählter Vertreter im „Bund der niederösterreichischen Landesangestellten“ in der Berufsvertretung aktiv.12
Aufgrund seines vielseitigen Engagements im Gemeinschaftsleben der Stadt wundert es kaum, dass er bald auch auf dem Feld der Kommunalpolitik aktiv wurde und so zog er anlässlich der Gemeinderatswahl im November 1929 als Kandidat der „Ständepartei“ in den Mistelbacher Gemeinderat ein. In Mistelbach hatten sich die Großdeutschen vor dieser Wahl in zwei Gruppen aufgespalten: die „Ständepartei“, den bürgerlicher Teil der Großdeutschen (hauptsächlich bestehend aus Gewerbetreibenden und Beamten) und den „deutschvölkischen Block“, der wie der Name nahelegt einen radikalen Deutschnationalismus verfolgte und von Anhängern der NSDAP angeführt wurde. Als Vertreter des Gemeinderates wurde Lang in den Verwaltungsausschuss des Bezirks-Krankenhauses und in den Ortsschulrat (1932-1939) entsandt. Im Juni 1931 wurde er schließlich zum Obmann der III. Sektion (Feuerwehr- und Friedhofsangelegenheiten) gewählt13, und obwohl er nicht dem Gemeindevorstand angehörte, soll neben Vizebürgermeister Dr. Steinbauer, auch Gemeinderat Lang in der Folge den häufig kränkelnden und bereits betagten Bürgermeister Josef Dunkl vertreten haben.14 Lang gehörte dem Gemeinderat (ab 1934 „Gemeindetag“) bis zu dessen Auflösung durch Beschluss der neuen nationalsozialistischen Machthaber am 13. März 1938 an.
 Franz Lang als Mitglied des Gemeindetages im Jahre 1935 (rotes x)
Franz Lang als Mitglied des Gemeindetages im Jahre 1935 (rotes x)
Nachdem das Dollfuß-Regime KPÖ, NSDAP und SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreichs) verboten hatte, wurden die verbliebenen politischen Kräfte (Christlich-soziale und Rest-Großdeutsche) in der Einheitspartei „Vaterländische Front“ (V.F.) gesammelt, der auch Lang angehörte. Ab 1937 scheint er als Hauptgruppenleiter, also Obmann, der Vaterländischen Front in Mistelbach auf.15 Inwiefern Lang als ehemaliger Anhänger der Großdeutschen sich tatsächlich für die „Vaterländische Idee“ (= der Erhalt der Selbstständigkeit Österreichs auf Basis christlich-ständischer Ordnung) bzw. den Führerkult um Dollfuß begeisterte oder die Betätigung in der V.F. eher aus opportunistischen Gründen erfolgte, bleibt unklar. Letzteres legt die Schilderung der oben bereits erwähnten Schwierigkeiten bei der Aufstellung der der Hermes Statue unter dem Titel „Vom Leidensweg eines Kunstwerks“ in einem im Juli 1939 erschienenen Zeitungsartikel in der Regionalzeitung Grenzwacht nahe. Darin ist zu lesen, dass gerade in jener Zeit als er noch für dessen Aufstellung kämpfte, sich die Ermordung von Dollfuß durch nationalsozialistische Putschisten im Juli 1934 ereignete und im Zug eines vom Regime propagierten Totenkults rund um den ermordeten Führer des Ständestaats, tauchte auch bald die Idee auf anstelle des Bildnisses von Hermes eine Dollfuß-Büste auf dem Conrad Hötzendorf-Platz (heute: Europaplatz) aufzustellen. Dies gefährdete Langs Plan für die Gestaltung des Platzes und laut eigenen Angaben habe er die Organisation rund um die angeregte Dollfuß-Büste lediglich an sich gezogen, um diese zu vereiteln. Und tatsächlich stand wenig später statt Dollfuß der „bedeckte“ Hermes auf dem Platz vor der gewerblichen Fortbildungsschule. Unter den Nationalsozialisten, die sich in ihrem Körperkult durchaus an den Schönheitsidealen der Antike orientierten, wurde schließlich das Bruchband entfernt und die Statue zeigte sich nunmehr in ihrem Originalzustand. Die (angebliche) Sabotage der Sammlung für eine Dollfuß-Büste dürfte wohl hauptsächlich aus eigensinnigen Beweggründen, nämlich zum Zwecke der Durchsetzung seiner Idee für die Gestaltung des Platzes erfolgt sein. Inwiefern dabei auch politische Beweggründe eine Rolle spielten ist fraglich, zweifellos versuchte Lang sich durch die im Artikel geschilderten Begebenheiten den neuen nationalsozialistischen Machthabern anzubiedern bzw. seine Rolle als führender Funktionär in der den Nazis verhassten Vaterländischen Front zu relativieren.16
 Das von Lang initiierte und 1945 abgebrochene Hermes-Denkmal vor der gewerblichen Fortbildungsschule (später Berufsschule, heute: Polytechnische Schule)
Das von Lang initiierte und 1945 abgebrochene Hermes-Denkmal vor der gewerblichen Fortbildungsschule (später Berufsschule, heute: Polytechnische Schule)
Seinen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP stellte er jedenfalls bereits im Juni 1938. Doch da es damals natürlich eine Vielzahl an Interessenten gab, galt eine Aufnahmesperre und erst mit 1. Jänner 1940 wurde Lang daher mit der Mitgliedsnummer 8,507.321 in die Partei aufgenommen.17 Wäre er in den Augen der Nationalsozialisten tatsächlich ein „Vaterländischer“ gewesen, wäre er wohl kaum in die NSDAP aufgenommen worden. Im Gegenteil: als Leiter der Vaterländischen Front in Mistelbach hätte er zweifellos Repressalien zu befürchten gehabt, wäre seine „nationale“ Gesinnung nicht über jeden Zweifel erhaben gewesen. Die bald nach dem Anschluss eingeführte nationalsozialistische Gemeindeordnung verwirklichte das Führerprinzip auch auf Gemeindeebene in der Person des Bürgermeisters, der die alleinige Entscheidungsgewalt innehatte und nicht mehr auf die Zustimmung oder Mitwirkung eines Kollegial- bzw. Kontrollorgans angewiesen war. Dem nationalsozialistischen Bürgermeister waren jedoch zwei Gremien beigegeben, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen bzw. beraten sollten. Einerseits die Beigeordneten (in Städten auch Stadträte genannt), die den Bürgermeister bei der Wahrnehmung der administrativen Verwaltungsaufgaben unterstützten bzw. ihn gegebenenfalls vertraten und die Gemeinderäte (in Städten Ratsherren genannt) die eine Art Sprachrohr zum Volk bildeten und über die Anliegen der Bürger an die Gemeindeverwaltung heranzutragen waren bzw. deren Meinung bei bestimmten Vorhaben anzuhören war. Entgegen anderslautender Angaben wurde Lang nicht erst 1944 von NS-Bürgermeister Huber als Ersatz für einen zur Wehrmacht eingezogenen Gemeinderat berufen und somit zum Ratsherrn ernannt, sondern er scheint in dieser Funktion bereits 1942 auf. Als Ratsherr wirkte Lang bis zum Untergang des NS-Regimes.18 Jedenfalls 1939 scheint Franz Lang außerdem Gemeindegruppenführer der Mistelbacher Ortsgruppe des Reichsluftschutzbundes – des zivilen Luftschutzverbandes, der die Bevölkerung auf das richtige Verhalten bei Luftangriffen bzw. den Umgang mit den Folgen (Verletzte, Brände, Gas, etc.) vorbereiten sollte, auf.19
Neben seiner Beschäftigung als angestellter Gärtner beim Landessiechenhaus hatte sich Lang gegen Ende des Krieges einen Betrieb als selbstständiger (Handels-)Gärtner gegenüber seines Dienstorts, unterhalb der Liechtensteinstraße (heute: Wohnhausanlage), aufgebaut. Dieses weitläufige Ackergrundstück, das jedenfalls bis zur Landesbahnstrecke reichte, hatte er bereits im Jahre 1930 käuflich erworben.20 Ob mit der erfolgreichen Selbstständigkeit sein Beschäftigungsverhältnis als Landesangestellter endete, oder ob dieses fortdauerte und/oder seine Mitgliedschaft in der NSDAP nach dem Krieg diesbezüglich negative Konsequenzen hatte, ist unklar.21 Nach 1945 wurden die ehemaligen Mitglieder der NSDAP registriert und besonders belastete Nazis mussten sich in einem Verfahren vor sogenannten Volksgerichten verantworten. In einem Bericht aus der ÖVP-Zeitung „Volks-Presse“, heißt es, dass die damals kommunistisch-sozialistisch dominierte Stadtregierung im September 1945 beschloss: „Herrn Gärtner Lang die Gärtnerei bis zur gerichtlichen Erledigung seiner Parteiangelegenheit zu führen“.22 Auch in einem anlässlich seines 70. Geburtstags erschienenen Portraits heißt es dort etwas kryptisch: „In den ersten Nachkriegsjahren musste Lang sein Lebenswerk gegen mißgünstige Zeitgenossen verteidigen.“23 Da im Landesarchiv Wien, dass die Volksgerichts-Akten vom Oberlandesgericht Wien übernommen hat, kein Akt zu einem Verfahren betreffend Lang vorhanden ist, scheint es kein Verfahren vor dem Volksgericht gegen ihn gegeben zu haben. Möglich wäre allerdings, dass Lang angezeigt wurde und die Voruntersuchung aufgrund falscher Anschuldigung bzw. in Ermangelung vorwerfbarer Handlungen eingestellt wurde. Schließlich war Lang weder illegales Mitglied, noch Funktionär der NSDAP und auch dürfte er keine Verbrechen gegen die Menschenwürde verübt haben (die drei wesentlichen Punkte zu denen Prozesse vor den Volksgerichten geführt wurden). Weder die Tätigkeit als Ratsherr der Stadt, das kein Parteiamt darstellte und mit dem auch keinerlei Entscheidungsgewalt verbunden war, noch das Engagement im Reichsluftschutzbund, stellen eine ausreichende Grundlage für ein gerichtliches Verfahren dar. Zwar wurde der Reichsluftschutzbund 1944 in die NSDAP überführt, und Lang hätte somit als Funktionär angesehen werden können, doch auch dies scheint selbst für eine Voruntersuchung eine zu dürftige Ausgangsposition gewesen zu sein. Lang dürfte die Führung seines Betriebs also bald wieder übernommen zu haben. Trotzdem sich in der Unternehmerschaft Mistelbachs viele andere, teils hochrangige Nationalsozialisten fanden, ist kein anderer Fall überliefert in dem die Gemeinde ein anderes privates Unternehmen zeitweilig übernommen und geführt hätte.
 Der langjährige Dienstort von Franz Lang: das einstige Landessiechenhaus in der Liechtensteinstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erkennbar die Beete der Gärtnerei Lang. Aufgenommen 1965, dem Sterbejahr Langs.
Der langjährige Dienstort von Franz Lang: das einstige Landessiechenhaus in der Liechtensteinstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erkennbar die Beete der Gärtnerei Lang. Aufgenommen 1965, dem Sterbejahr Langs.
Bei den ersten Gemeinderatswahlen nach dem Krieg im Mai 1950 wurde Lang als Kandidat der Österreichischen Volkspartei in den Mistelbacher Gemeinderat gewählt. Im Zuge der konstituierenden Gemeinderatssitzung hatten ihn seine Parteikollegen auch als Bürgermeisterkandidaten vorgeschlagen, Lang hatte dies jedoch abgelehnt.24 Allerdings wurde Lang als geschäftsführender Gemeinderat (=Stadtrat) gewählt und war als Markt-, Feuerwehr-, Friedhofs- und Parkreferent, Vorsitzender der für diese Bereiche zuständigen Sektion. Besondere Verdienste erwarb sich Stadtrat Lang beim Bau der 1957 eröffneten Markthalle („Sauhalle“, Vorgängerbau des Stadtsaals), dem 1960 eingeweihten Neubau des heutigen Feuerwehr- und Garagengebäudes und im Bereich der Friedhofsgestaltung bzw. -verwaltung. Doch beschränkte sich Lang keineswegs auf diese Themenfelder, sondern regte auch in vielen anderen Gebieten der Gemeindearbeit Verbesserungen an, die bereitwillig aufgegriffen und umgesetzt wurden.25 Darüber hinaus war Stadtrat Lang auch Ansprechpartner für die Siedler in der Totenhauersiedlung, die aufgrund der Abgeschiedenheit bzw. Entfernung zum Stadtgebiet mit besonderen Herausforderungen (bspw. Wasserversorgung) konfrontiert waren. Ab 1952 gehörte Lang auch dem Verwaltungsrat der Sparkasse der Stadt Mistelbach an, ab 1957 dem Vorstand dieser Institution und ab 1958 bekleidete er schließlich das Amt des Vorsitzenden des Vorstandes.26 In letzterer Funktion war er maßgeblich an der Sicherstellung der Finanzierung zahlreicher Gemeindeprojekte über die Grenzen seiner Zuständigkeit als Stadtrat hinaus, beteiligt.27 Nach insgesamt 20 Jahren in der Gemeindevertretung, zog er sich 1960 aus dieser Funktion zurück28 und anlässlich seines Ausscheidens aus dem Gemeinderat beschloss selbiger am 15. Juni 1960 ihm für sein langjähriges verdienstvolles Wirken im öffentlichen Leben den Ehrenring der Stadt Mistelbach zu verleihen.29
Auch im Vereinsleben nach dem Zweiten Weltkrieg war Stadtrat Lang an führender Stelle tätig: er war Mitglied im Ortsbauernrat, Obmannstellvertreter des Jagdausschusses und gehörte dem Ausschuß zur Wiedergründung des Musik- und Gesangsvereins an und wurde auch zu dessen Ehrenobmann ernannt. Äußerst aktiv war er außerdem im Verein „Volkshochschule – Kultur- und Verschönerungsverein“, dem Nachfolger zweier Vereine bei denen er bereits in der Zwischenkriegszeit aktiv war. 1955 initiierte Stadtrat Lang das jährlich um Allerheiligen stattfindende „Heldengedenken“ auf dem Friedhof – die Gedenkfeier der Stadt für die Toten beider Weltkriege.30 Auch in der Vertretung seines Berufsstandes, war er auf Bezirks- und Landesebene in der Landes-Gartenbauvereinigung für Niederösterreich31, sowie in der nö. Landwirtschaftskammer, engagiert. Laut einem Zeitungsbericht gedachte Gärtnermeister Lang sich 1962, anlässlich seines 70. Geburtstags, aus dem Berufsleben zurückzuziehen, allerdings findet sich Langs Gärtnereibetrieb noch 1965, im Sterbejahr des Betriebsgründers, in Gewerbeadressbüchern, ehe die Geschäftstätigkeit endgültig endete.32 Altstadtrat Langs letzter Dienst am Gemeinwesen dürfte wohl seine Mitarbeit an der 1964 anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums der Stadterhebung erschienenen „Mistelbacher Chronik 1914-1964“, die im Rahmen der Reihe „Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart“ veröffentlicht wurde, gewesen sein.33
Franz Lang verstarb am 29. November 1965 und wurde fünf Tage später auf dem Mistelbacher Friedhof bestattet. 1974 beschloss der Mistelbacher Gemeinderat den Franz Lang-Weg im Gedenken an das gemeinnützige Wirken von Stadtrat Lang zu benennen.
Wo befindet sich der Franz Lang-Weg?
Bildnachweis:
Portrait Lang: Volks-Post, Nr. 8/1962, S. 4
Gemeinderat 1935 & Hermesdenkmal (gewerbliche Fortbildungsschule): Stadt-Museumsarchiv Mistelbach
Landessiechenhaus: aus der Sammlung von Frau Rehrmbacher
Quellen:
-) Weinviertler Nachrichten, Nr. 15/1960, S. 1f (Anm.: hier wird der Zeitpunkt des Zusammenschlusses der beiden Gesangsvereine fälschlicherweise mit 1929 angegeben.)
-) Volks-Post, Nr. 8/1962, S. 4
-) Mitteilung der Stadtgemeinde Mistelbach, Folge 117 (Dezember 1965), S. 3
- Pfarre Mistelbach: Taufbuch (1883-1894), Fol. 303
Eintrag Taufbuch Pfarre Mistelbach - Mistelbacher Bote, Nr. 15/1930, S. 3
- Bund der niederösterreichischen Landesangestellten (Hrsg.): Niederösterreichicher Almanach 1929, S. 96 (ONB: ANNO);
Bund der niederösterreichischen Landesangestellten (Hrsg.): Niederösterreichischer Almanach 1930, S. 85 (ONB: ANNO);
Bund der niederösterreichischen Landesangestellten (Hrsg.): Niederösterreichischer Almanach 1931, S. 83 (ONB: ANNO);
Bund der niederösterreichischen Landesangestellten (Hrsg.): Niederösterreichischer Almanach 1932, S. 87 (ONB: ANNO);
Bund der niederösterreichischen Landesangestellten (Hrsg.): Niederösterreichischer Almanach 1933, S. 85 (ONB: ANNO);
Anm.: Leider werden im „Niederösterreichischer Almanach“ vor 1929 lediglich die Namen der Verwalter bzw. der medizinischen Leiter der Landessiechenanstalten namentlich angeführt, sodass unklar ist, wann Lang seinem Vater im Beruf nachfolgte. Die letzte Ausgabe des Niederösterreichischen Almanachs erschien 1933, doch steht außer Zweifel, dass Lang die Stelle auch darüber hinaus bekleidete. - k. u. k. Kriegsministerium (Hrsg.): Verlustliste vom 28. März 1918
- Donauwacht, 26. April 1940 (61. Jg. – Folge 17), S. 10 (ONB: ANNO)
- Pfarre Mistelbach: Trauungsbuch (1912-1927), Fol. 265
Eintrag Trauungsbuch Pfarre Mistelbach - historisches Grundbuchsblatt Einlagezahl: 2451 (Mistelbach) im Niederösterreichischen Landesarchiv (Außenstelle Bad Pirawarth)
- Bollhammer, Fritz: 100 Jahre Gesangs- und Musikverein (1864 Mistelbach) In: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, Band I (1964), S. 202
- Festschrift 120 Jahre Stadtchor Mistelbach – 1864-1984, S. 15;
Weinviertler Nachrichten, Nr. 15/1960, S. 1f (Anm.: hier wird der Zeitpunkt des Zusammenschlusses der beiden Gesangsvereine fälschlicherweise mit 1929 angegeben.) - Mistelbacher Bote, Nr. 6/1934, S. 4
- Mistelbacher Bote, Nr. 18/1933, S. 2
- Bund der niederösterreichischen Landesangestellten (Hrsg.): Niederösterreichicher Almanach 1929, S. 293 (ONB: ANNO);
Bund der niederösterreichischen Landesangestellten (Hrsg.): Niederösterreichischer Almanach 1933, S. 278 (ONB: ANNO); - Bayer, Franz/ Spreitzer, Prof. Hans: „Der Mistelbacher Gemeinderat seit der Stadterhebung“ In: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, Band I (1964), S. 173
- Volks-Post, Nr. 8/1962, S. 4
- Mistelbacher Bote, Nr. 28/1937, S. 4 (ONB: ANNO);
Mistelbacher Bote, Nr. 42/1937, S. 4 (ONB: ANNO);
Mistelbacher Bote, Nr. 48/1937, S. 4 (ONB: ANNO) - Grenzwacht (Beilage Kreis Mistelbach), Nr. 27/1939, S. 10
- laut seiner Karteikartei in NSDAP-MItgliederkartei im Bundesarchiv Berlin, Gaukartei – Signatur: BArch R 9361-IX KARTEI / 24640691 Karte
- Donauwacht, Folge 46/1942, S. 6 (ONB: ANNO);
Bayer, Franz/ Spreitzer, Prof. Hans: „Der Mistelbacher Gemeinderat seit der Stadterhebung“ In: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, Band I (1964), S. 174 (Anm.: die Angabe Lang sei im Frühjahr 1944 aufgrund des Einrückens von Ing. Fritz Hrachowina, diesem in seiner Funktion als Ratsherr nachgefolgt ist falsch. Hrachowina diente bereits zuvor bei der Wehrmacht (Donauwacht, Folge 41/1943, S. 6 (ONB: ANNO)) und wie erwähnt scheint Lang bereits 1942 als Ratsherr auf. - Grenzwacht, Folge 20/1939, S. 14 (ONB: ANNO);
Grenzwacht, Folge 36/1939, S. 12 (ONB: ANNO) - historisches Grundbuchsblatt Einlagezahl: 2452 (Mistelbach) im Niederösterreichischen Landesarchiv (Außenstelle Bad Pirawarth)
- Im Herbst 1943 war Lang jedenfalls noch als Obergärtner der nunmehrigen Landespflegeanstalt beschäftigt: Donauwacht, 1. Oktober 1943 (63. Jg. – Folge 39), S. 8 (ONB: ANNO)
- Oesterreichische Volks-Presse, Nr. 17/1956, S. 9
- Volks-Post, Nr. 8/1962, S. 4
- Volks-Post, Nr. 8/1962, S. 4
- Weinviertler Nachrichten, Nr. 15/1960, S. 1f
- Festschrift „Zur Weihe und Eröffnung des neuen Sparkassengebäudes in Mistelbach“, Oktober 1966 In: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart (1966), S. 317
- Weinviertler Nachrichten, Nr. 15/1960, S. 1f
- Die Bürgermeister Mistelbachs ab 1850, die Stadträte und Gemeinderäte Mistelbachs seit der Stadterhebung im Jahre 1874 (1982) In: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, Band III, S. 104
- Niederösterreichische Volks-Presse, Nr. 27/1960, S. 5
- Mistelbacher Bote, Nr. 45/1955, S. 4;
Niederösterreichische Volks-Presse, Nr. 46/1960, S. 4 - 1944 scheint er als Kreisfachwart für Gartenbau auf: Donauwacht, 5. Mai 1944 (64. Jg. – Folge 18), S. 8 (ONB: ANNO);
1949 scheint er etwa als Obmann der Gärtnervereinigung Mistelbach auf: Mistelbacher Bote, Nr. 14/1949, S. 3 (ONB:ANNO) - Herold, Adressbuch von Österreich – Band III Industrie, Handel, Gewerbe (Wien, Niederösterreich, Burgenland) 1965
- Göstl, Georg/ Leithner, Johann/ Weidlich, Alfred/ Steiner, Oskar/ Kummer, Johann: „Mistelbacher Chronik von 1914 bis 1988“, Band IV (1989) der Reihe Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, S. 1